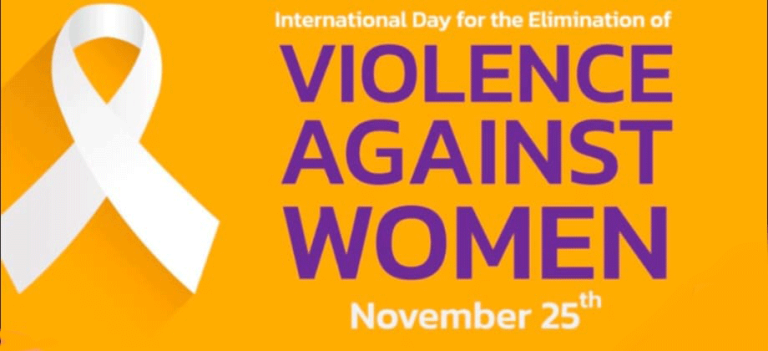Teures, ineffizientes Familienrecht – Zeit für ein neues Paradigma
Österreich leistet sich den Luxus eines sehr teuren und zugleich extrem ineffizienten Familienrechtes zu Lasten der Familien. Dort, wo es um Beziehungen geht, werden Paragraphen bemüht, Akten gewälzt und Stellvertreterkämpfe durch Expert:innen und Anwält:innen geführt.
Worin liegt diese Feststellung begründet? Nehmen wir dafür einen exemplarischen Fallverlauf her. Die Eltern trennen sich und haben unterschiedliche Interessen, was die Betreuungszeiten ihres Kindes betrifft. Im besten Fall holen sie sich Hilfe in Form einer Mediation, finden aber trotzdem zu keiner Einigung. Ein Elternteil beschreitet den Weg zum Gericht und bringt einen Antrag ein.
Bis es zur ersten Tagsatzung (Gespräch vor Gericht mit beiden Elternteilen) kommt, vergehen mehrere Monate. Eine Zeit der Anspannung. Endlich vor Gericht, kommt es ebenfalls zu keiner Einigung. Das Gericht schickt die Eltern in eine Erziehungsberatung. Stellt sich ein Elternteil dem Beratungsprozess entgegen und kommt einfach nicht bzw. hält stur an der eigenen Position fest, scheitert auch dieser Weg. Gibt es einen Elternteil der für‘s Scheitern maßgeblich verantwortlich ist, erfährt das Gericht dies nicht bzw. nur aus dem Mund der Eltern. Diese schieben einander gegenseitig die Schuld zu. Die Berater:innen unterliegen der Verschwiegenheit. Die Möglichkeit, dem „destruktiven“, nämlich sich am Beratungsprozess nicht ernsthaft beteiligenden, Elternteil gezielt etwas entgegenzusetzen, bleibt ungenützt. Das Gericht beauftragt in der Folge die Familiengerichtshilfe (FGH). Dabei hat dieses – je nach Einschätzung – die Möglichkeit, einen Schlichtungsversuch durch die Familiengerichtshilfe (Clearing) anzuordnen oder gleich eine schriftliche Stellungnahme zur Kontaktrechtfrage einzufordern. Wieder vergehen drei bis sechs Monate. In der Stellungnahme fühlt sich der eine und/oder die andere falsch dargestellt. Die vorgeschlagene Lösung findet meist bei zumindest einem Elternteil keinen Gefallen. Das Gericht fasst trotzdem einen Beschluss. Einer der beiden Elternteile fühlt sich in der Regel ungerecht behandelt und geht in den Rekurs (das Landesgericht ist beschäftigt). Oder das Gericht fordert gleich ein Sachverständigengutachten ein. Je nachdem – wieder vergehen sechs bis zwölf Monate. Das Gutachten kostet rund 6000 Euro. Haben beide Elternteile ein geringes Einkommen, übernimmt der Staat die Kosten dafür. In der Zwischenzeit sind immer wieder Kontakte ausgefallen, ein Kinderbeistand wird eingesetzt. Besuchsmittlung wird durch die FGH zur Verfügung gestellt. Beide oder nur ein Elternteil haben mittlerweile unzählige Anträge eingebracht, um die jeweils empfundenen Ungerechtigkeiten darzulegen, das Verfahren zu beschleunigen oder aber den eigenen Interessen gemäß zu verschleppen. Alle Anträge müssen der gegnerischen Partei und/oder einer übergeordneten Behörde zugestellt werden, um deren Rechtmäßigkeit zu prüfen. Fristsetzungsanträge und Friststreckungsanträge, Befangenheits- bzw. Ablehnungsanträge u.a.m. Der Akt wächst. Eine Einigung ist so weit entfernt wie nie. Beschlüsse werden von den Eltern nicht umgesetzt, Vereinbarungen nicht eingehalten. Vor Sanktionen scheut das Gericht zurück. Aufgrund der verstrichenen Zeit haben sich die Dinge verändert. Ein zweites Gutachten wird eingefordert. Auch dieses hinterlässt mindestens einen Verlierer: jenen, dessen Hoffnung auf Unterstützung seiner Position nicht erfüllt wird. Neuerliche Rekursverfahren u.a.m. folgen.
Parallel dazu läuft ein Unterhaltsverfahren. Ein Elternteil gibt die Unterhaltsforderungen in die öffentliche Hand (Jugendwohlfahrtsbehörde), die wiederum ihre Anträge an das Gericht weiterleitet und Beschlüsse einfordert. Nicht wenige solcher Verfahren ziehen sich über Jahre, sind personalintensiv und somit teuer.
Nebenbei geben viele Eltern Tausende an Euros für Anwälte aus, welche sich immer wieder als Brandbeschleuniger herausstellen und nicht selten die einzigen Gewinner sind (um Anwälten nicht pauschal unrecht zu tun, sei erwähnt, dass sie im Auftrag ihrer Klienten handeln und ein Gutteil von ihnen auch ehrlich darum bemüht ist zu deeskalieren).
Dass es nicht nur effizienter, sondern auch viel billiger sein könnte, lässt sich zunächst am Beispiel Australiens aufzeigen. Australien hat sich 2006 von einem ähnlichen System wie dem unsrigen verabschiedet und geht seither einen völlig neuen Weg. Statt sich an ein Gericht zu wenden, müssen die Eltern im ersten Anlauf ein so genanntes „Family Relationship Center“ (FRC) aufsuchen. Gleichzeitig wurde die Doppelresidenz (mind. 11 Tage pro Monate bis hin zur hälftigen Betreuung) zum Leitbild erklärt. Der Besuch eines FRC ist verpflichtend. Hier bieten speziell geschulte multiprofessionelle Teams Beratung an. Die Wirksamkeit gesetzlich angeordneter Beratung ist seit vielen Jahren aus anderen Bereichen bekannt (Jugendwohlfahrt, Jugendstrafrecht, bei Drogendelikten etc.). Kein Antrag, sondern Gespräche stehen also an erster Stelle. Kann keine Einigung gefunden werden, müssen beide Elternteile einen „Kind-im-Blick-Kurs“ absolvieren. Dort erfahren Eltern in einer Gruppe mit anderen Eltern (aber ohne den/die eigene/n Expartner:in), was ihr Konflikt für ihre Kinder emotional bedeutet und welche psychischen Auswirkungen er für sie langfristig haben kann. Von anderen Eltern das eigene Verhalten gespiegelt zu bekommen, bringt viele Eltern zur Besinnung und lässt sie in der anschließenden Mediation konstruktiv an gemeinsamen Entscheidungen für das Kind arbeiten. Ziel ist es also, Verständnis für die eigenen Schutz- und Verhaltensstrategien und die des Gegenübers zu gewinnen und das Kind nicht für eigene Zwecke zu missbrauchen. Erst wenn auch dieser Schritt scheitert, kann der Weg über das Gericht beschritten werden.
Wie auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen übernimmt der Gesetzgeber hier Verantwortung, indem er einen gewissen Druck auf jene Personen (Eltern) ausübt, die sich eines destruktiven Verhaltens bedienen. Das Kindeswohl wird hiermit auch im Scheidungsfall endlich ernst genommen. Ausgrenzendem Verhalten sowie jenen Verhaltensstrategien, die den Loyalitätskonflikt des Kindes, das emotional zwischen den Eltern steht, verstärken, wird entschieden entgegengewirkt. Beschlüsse werden am Kindeswohl orientiert und konsequent durchgesetzt. Und dies bei insgesamt geringeren Kosten. Zum Vergleich: Die Verfahrenskosten für ein Gerichtsverfahren wurden im Durchschnitt mit 8.817,- Dollar beziffert, die über das FRC mit 1.400,-.
Mit Blick auf hiesige Verfahren wird deutlich, dass Österreich einem veralteten Paradigma folgt: Nach einer Trennung darf nur ein Elternteil die Hauptbetreuung übernehmen. Diese Asymmetrie ist Leitbild. Die Hoffnung, dass dadurch Konflikte gar nicht erst aufkommen, weil nur ein Elternteil in der Zuständigkeit ist, hat sich als fataler Irrtum erwiesen, wie die zahllosen Verfahren und endlosen Streitigkeiten (mit und ohne Gericht) belegen.
Schauen wir uns im Detail an, wie sich diese Asymmetrie in der Praxis aus systemischer und konfliktdynamischer Perspektive auswirkt. Sie beginnt bereits mit einer schiefen Ebene in der gemeinsamen Obsorge. Bei unehelichen Kindern erhält die Mutter diese automatisch. Der Vater bekommt sie kampflos nur mit dem Einverständnis der Mutter. Das Konfliktfeld ist eröffnet. Viele Väter scheuen bei aufrechter Beziehung davor zurück, den Weg zum Gericht zu beschreiten. Das Gericht soll doch nicht in die Beziehung getragen werden. Trennen sich die beiden, hat der Elternteil ohne Obsorge automatisch schlechtere Karten. Das Prinzip der „schiefen Ebene“ – ein „Unten“ und ein „Oben“ – ist somit gesetzlich verankert.
Trennen sich die Eltern und finden zu keiner Einigung – auch nicht mit Beratung –, müssen Anträge eingebracht werden. Dass Eltern in dieser Situation emotional oft in einem Ausnahmezustand sind und ev. auch gegen ihren Willen Begleitung benötigen, wird nicht wahrgenommen. Der Stellvertreterkrieg beginnt. Anwälte werden bemüht. Um die eigene Position zu stärken und die andere zu schwächen, werden in den Anträgen die Fehler des jeweils anderen möglichst zugespitzt oder übertrieben dargestellt und nicht selten alte, längst abgehandelte Vorwürfe wieder ausgegraben. Das Gegenüber ist verletzt und empört und schlägt entsprechend zurück. Die Konfliktspirale nimmt an Fahrt auf.
Droht nun die als besonders wichtig empfundene Beziehung zum Kind im Falle einer Trennung verloren zu gehen, kämpft man umso vehementer. Das Gesetz sieht bis zur endgültigen Kontaktregelung die Verankerung einstweiliger Kontakte vor. Über einen Zeitraum von einem halben Jahr soll i.d.R. ein minimales Kontaktrecht festgelegt werden. Um am Ende sein „Zuviel“ zu verteidigen oder sein „Zuwenig“ zu bekämpfen, hat man ein halbes Jahr Zeit, um aufzurüsten. Ziehen wir wieder einen Ländervergleich, diesmal zu Frankreich. Dort wird die Doppelresidenz als Übergangsregelung festgelegt. Nur wenn sich herausstellt, dass diese nicht die beste Regelung ist, wird von ihr wieder abgegangen.
Eine Fortsetzung der „schiefen Ebene“ finden wir weiters im Vollzug der Gesetze. Anstatt Eltern in die Lage zu versetzen, verantwortungsvoll im Sinne des Kindes zu entscheiden, wird das Schlachtfeld ausgebreitet (siehe oben). Die kurzsichtige und defensive Haltung des Justizministeriums „Beschlüsse gegen den Willen eines Elternteils landen nur auf dem Rücken des Kindes“ eröffnet einen rechtsfreien Raum. Gerichte, dementsprechend „gefesselt“, fassen oft über Jahre keine Beschlüsse oder setzen bereits gefasste Beschlüsse einfach nicht durch.
Der weit verbreitete Glaubenssatz „Zum Streiten gehören immer zwei“ mit der impliziten Annahme, dass immer auch beide gleich verantwortlich dafür sind, zeitigt ebenso fatale Folgen. Es gibt kaum ein Bemühen herauszufinden, ob es sich um einen symmetrischen oder um einen asymmetrischen Konflikt handelt. Dies hat zur Folge, dass dem destruktiven Verhalten beider – oder eben nur einer Person – kein Einhalt geboten wird. Auch wenn nur ein Elternteil mit seinem Verhalten einer Lösungsfindung entgegensteht, werden beide in Beratung geschickt. Der destruktive Teil darf auch dort getrost so weitermachen, denn die Beratungsstellen unterliegen der Verschwiegenheit. Alternativ werden wieder Experten befragt. Ein Ende ist nicht in Sicht.
Aus der Perspektive eines fünfjährigen Kindes (die Gruppe der Kinder, die am häufigsten von Trennung betroffen sind) bedeutet es in den überwiegenden Fällen, den emotional verletzten Eltern schutzlos ausgeliefert zu sein, bewusst oder unbewusst zum Bündnispartner des einen gegen den anderen Elternteil instrumentalisiert zu werden und sich sehr oft für einen und gegen den anderen entscheiden zu müssen, auch wenn die Sehnsucht beiden gilt. Kinder werden einem völlig verfehlten Regelwerk – bestehend aus Gerichten, Anwälten, Sachverständigen, Psychologen, Anträgen und Gegenanträgen, Fristsetzungs- und Friststreckungsanträgen, Befangenheitsanträgen und Rekursen – über Jahre ausgeliefert, anstatt die emotionstrunkenen Eltern an die Hand zu nehmen und ihnen dabei zu helfen, sich wieder zu ordnen und zu lernen, verantwortungsvolle Entscheidungen für ihr gemeinsames Kind zu treffen. Dort, wo Beziehungsarbeit gemacht werden müsste, gehen Kinder in einem Meer von Paragraphen und Aktenläufen unter.
Zusammengefasst kann festgestellt werden: Wird zwischen Eltern im Zugang zum Kind rechtlich und verfahrenstechnisch die schiefe Ebene zum Grundsatz, weht unausweichlich der Geist des Konfliktes. Nimmt man Eltern die Entscheidung der Beziehung zum von beiden gleichermaßen geliebten Kind aus der Hand, bleiben Motive wie Verlustängste, Rache, Neid u.v.a.m. im Verborgenen und entfalten erst recht ihre Kraft. Gibt es im Verfahren keine Verbindlichkeit, werden Beschlüsse nicht umgesetzt und Vereinbarungen nicht eingehalten, bahnt sich Destruktivität ihren Weg und können Konflikte nicht zur Ruhe kommen. Langwierige, extrem teure, frustrierende und letztlich kindeswohlgefährdende Verfahren bestimmen den Alltag.
Anton Pototschnig
Dipl. Sozialarbeiter
Obmann der Plattform Doppelresidenz und der Initiative „Wir Väter“
Wien, April 2025