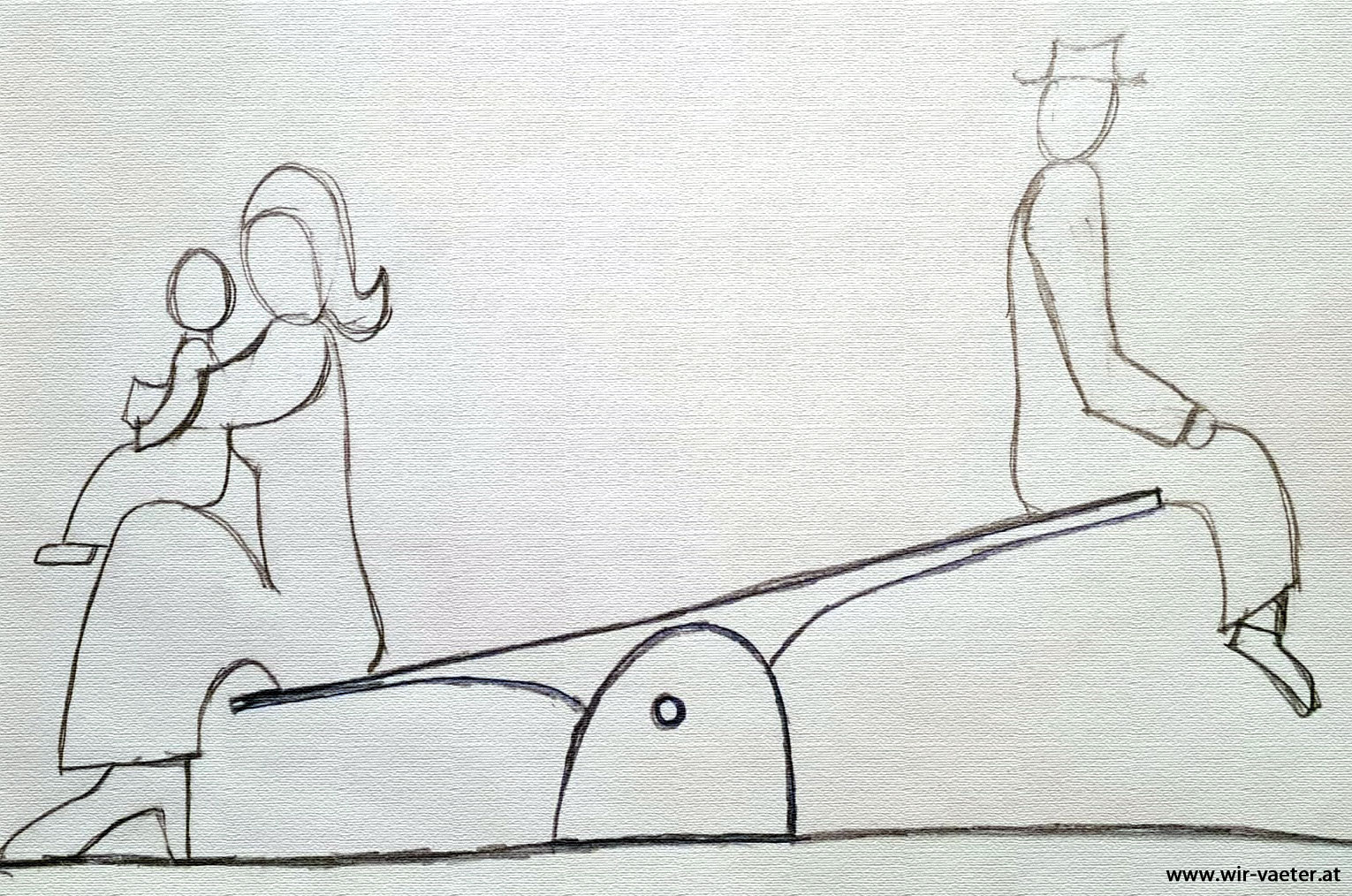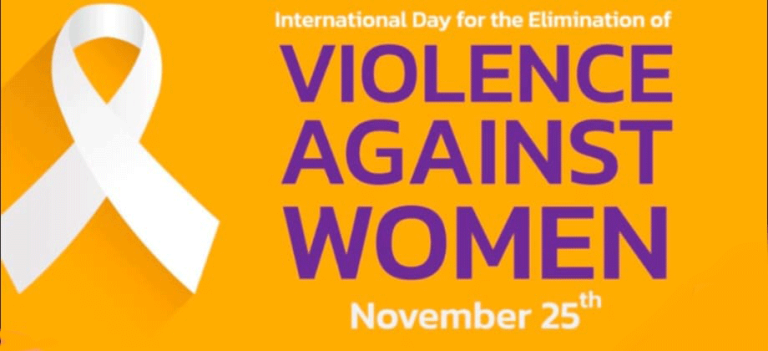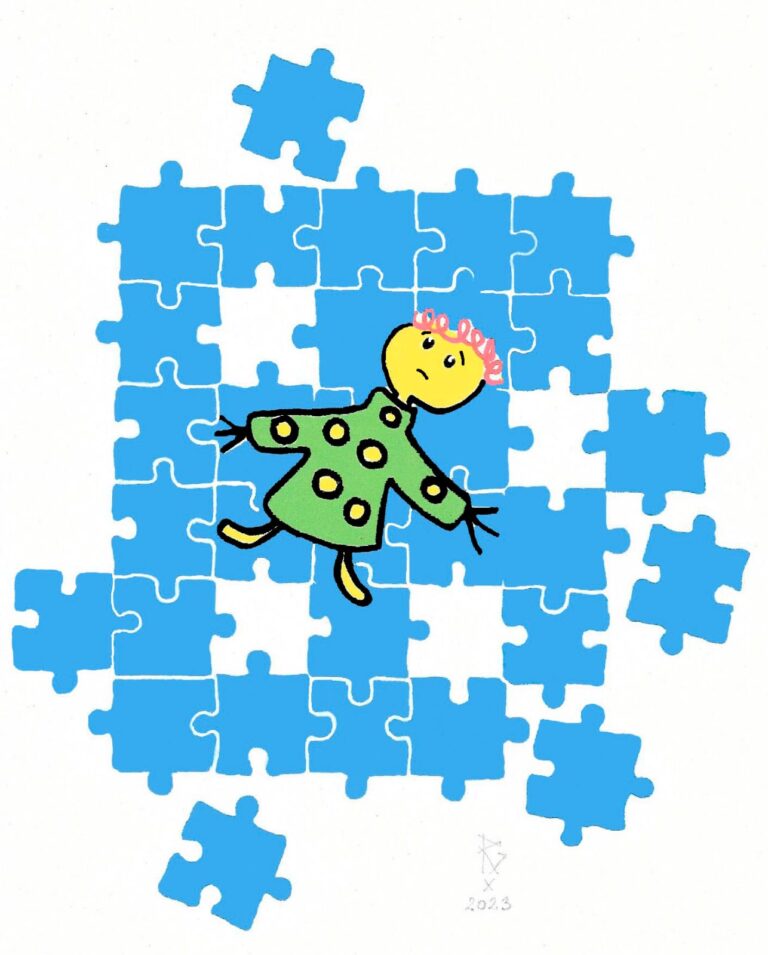Doppelresidenz – Mythen und Fakten
Oder, warum sie gesetzlich verankert gehört.
Immer mehr Eltern wollen nach einer Scheidung/Trennung ihre Kinder gleichteilig betreuen (Doppelresidenz). Der Weg dorthin gestaltet sich nicht immer einfach. Treffen Eltern auf Professionist:innen, stoßen sie oft auf persönliche Haltungen anstatt fundiertem Wissen. Nicht selten werden so ideologisch geprägte Expertenmeinungen zu Gratmessern zukünftiger Entscheidungen von Trennungsfamilien. Egal wie das Betreuungsmodell aussieht, müssen Eltern immer einen hauptsächlichen Aufenthalt festlegen, auch wenn ihnen eine ausgewogene Situation und gleiche Rechte wichtig sind. Denn, selbst wenn Eltern eine halbe/halbe Regelung vereinbaren, sind sie gezwungen, einen hauptsächlichen Aufenthalt bei der Mutter oder dem Vater festzulegen. Ein Elternteil wird damit automatisch rechtlich und finanziell bevorzugt bzw. benachteiligt.
Stellt sich ein Elternteil gegen das Doppelresidenzmodell – meist sind es Mütter – wird es für Väter in der Regel schwer, bis unmöglich dieses zu erwirken. Immer wieder müssen sich Väter (und Kinder) – auch wenn die Eltern vor der Trennung gleichermaßen betreut haben – damit abfinden, dass die Vater-Kind-Beziehung auf 14-tägige Besuchswochenenden beschränkt wird.
Manche Feminist:innen klagen Väterorganisationen an, mit der Doppelresidenz lediglich lästigen finanziellen Verpflichtungen entkommen zu wollen und im Falle der Doppelresidenz die Kinder sowieso nur bei den Großeltern abzugeben. Und im Übrigen ginge es ihnen nur um Kontrollrechte gegenüber den Müttern.
Solche Vorwürfe werden zwar mantraartig wiederholt, aber werden sie deshalb wahrer? Egal auf welche Väterinitiative man blickt, wird vor allem auf zwei Momente verwiesen: Väter wollen nach der Trennung einerseits mit ihren Kindern in Kontakt bleiben und Zeit mit ihnen verbringen und andererseits darin nicht willkürlich eingeschränkt werden.
Völlig ausgeblendet wird von manchen Feministinnen, dass sich Männer in Bezug auf ihr Verständnis vom Vatersein schlicht und einfach verändert haben. Der Großteil der Väter verbringt die Freizeit mit der Familie. Männer werden von anderen Männern deswegen nicht mehr schief angeschaut. Gelebtes Vatersein wird zur neuen und emanzipierten Normalität.
Tatsächlich verändert sich aber mit der Doppelresidenz die finanzielle Verpflichtung der Eltern gegenüber dem Kind. Der geplante Gesetzesentwurf sah vor, dass sich das bisherige Berechnungsschema ändert, wenn jeder Elternteil das Kind zumindest mehr als 1/3 der Zeit betreut (anders ausgedrückt mindestens 11 von 30 Tagen im Monat). Ab diesem Zeitpunkt ist nicht mehr nur ein Elternteil dem Kind gegenüber alimentationspflichtig, sondern beide – je nach Betreuungszeit und Einkommensverhältnis. Tatsächlich reduziert sich der Betrag der monetären Leistung, der bisher von der Mutter verwaltet wurde (den Anspruch hatte immer schon das Kind), mit der neuen gegenseitigen Berechnung stark.
Genau darauf machen manche Feminist:innen zu Recht aufmerksam und stemmen sich gegen die Doppelresidenz insgesamt. Wir kommen später darauf zurück. Zuerst sollte jedoch ein grundsätzlicher Blick auf das Modell der Doppelresidenz geworfen werden.
Ein bedeutender Faktor bei der Trennung der Eltern ist die Kontinuität des Kindes in Bezug auf seine Bindungspersonen. Kinder bauen in der Regel zu beiden Elternteilen gleichwertige Beziehungen und Bindungen auf. Die Reduktion der Kontakte zu einem Elternteil auf 14-tägige Kontakte läuft dementsprechend dem Wunsch nach Kontinuität zuwider. Wissenschaftliche Ergebnisse untermauern diese Annahme seit Jahrzehnten. Eine Fülle von Studien verweist im Wesentlichen auf die Überlegenheit der Doppelresidenz gegenüber dem Residenzmodell. Diese Studien zeigen, dass Kinder in Doppelresidenz ausgeglichener, psychisch stabiler, leistungsfähiger und besser an beide Elternteile gebunden sind als Kinder im Residenzmodell. Selbst die Bindung zur Mutter verbessert sich durch die Doppelresidenz (das Gegenteil wird in der Regel befürchtet). Ebenso ist die Konfliktdynamik geringer und die Kooperation der Eltern besser. Diese Studien (siehe https://www.doppelresidenz.at/fachartikelstudien/) werden von Gegner:innen des Modells schlicht und einfach geleugnet oder einfach ignoriert.
Prominente Kritik bekommt die Doppelresidenz in letzter Zeit auch von Gertrude Bogyi, Psychotherapeutin und ehemalige Leiterin der Kinderschutzeinrichtung „Die Boje“. In der Zeitung „die Furche“ zeigt sie sich überzeugt davon, dass Kinder ein Heim erster Ordnung benötigen. Früher, meint sie, hätte man das noch sagen dürfen, jetzt sei das völlig verpönt. Kinder wissen nicht, wo ihr zu Hause sei und wären völlig verwirrt, ob des ständigen Wechsels. Bogy bezieht sich dabei auf Aussagen von Kindern, die sie im Laufe der Jahre betreute. Kinder hätten Angst, die Wahrheit zu sagen und würden aus Loyalitätsgründen dem Modell zustimmen, aber tatsächlich…
Das prominente Entwicklungspsychologen, wie Harald Werneck von der Uni-Wien und Helmuth Figdor, Institut für Bildungswissenschaften, meinen, dass Kinder in der Regel kein Problem mit dem Wechsel haben, quittiert sie mit einem: „Ja, das sagt sich leicht…“ und qualifiziert damit deren, auf Jahrzehnte basierende Expertise, einfach ab. Das „Heim erster Ordnung“ wird wieder zur Maxime erklärt. Völlig ignoriert wird dabei, dass Kinder in der Regel Bindungen zu beiden Elternteilen gleichermaßen aufbauen und mit dem Residenzmodell eine Beziehung auf 4 Tage pro Monat reduzieren müssen. Vor die Wahl gestellt, der örtlichen Kontinuität oder der Beziehungskontinuität zu den beiden wichtigsten Menschen zu ermöglichen, fällt die Entscheidung bei Bogy für das „Heim erster Ordnung“.
Aus Studien und aus Gesprächen mit Eltern und ehemaligen „Doppelresidenz-Kindern“ im Rahmen meiner 30jährigen Tätigkeit als Sozialarbeiter weiß ich, dass Kinder den Wechsel immer wieder als beschwerlich und nervig erleben. Die Möglichkeit zu beiden Elternteilen kontinuierlich Kontakt halten zu können, ist ihnen jedoch wichtiger. Sie würden auch im Nachhinein dieselbe Entscheidung treffen.
Ganz nüchtern betrachtet aber ist die Wechselfrequenz beim Doppelresidenzmodell nicht automatisch häufiger als beim Residenzmodell. Im Gegenteil. Im Residenzmodell, mit Kontakten, die in der Freizeit, also am Wochenende und im Alltag stattfinden, wechseln Kinder pro Monat 8 Mal, während Kinder bei der häufigsten Wechselfrequenz, dem wöchentlichen Pendeln, nur 4 x wechseln. Bei kleineren Kindern kommt es in der Regel zu häufigeren Wechseln im Doppelresidenzmodell. An dieser Stelle erlauben Sie einen Vergleich: Kinder, die zur Tagesmutter oder in den Kindergarten gehen, aber auch immer wieder bei Oma und Opa Zeit verbringen, wechseln sehr häufig die Bezugspersonen und lieben es in der Regel. Ein afrikanisches Sprichwort besagt, dass es zum Erziehen eines Kindes ein ganzes Dorf benötigt.
Ungeachtet dessen ist es wichtig, bei diesem, sowie jedem anderen Modell darauf zu achten, dass das gelebte Modell zu den Kindern passt. Das betrifft aber sowohl die Doppelresidenz als auch das Residenzmodell. Sprechen sich Kinder in nachvollziehbarer Weise dagegen aus oder zeigen Auffälligkeiten, muss man darauf reagieren, unabhängig davon, ob ein Elternteil sich was anderes wünscht. Nicht das Elternwohl steht im Mittelpunkt.
Aufgrund der klaren Befunde und positiven Erfahrungen mit der Doppelresidenz in vielen Ländern hat man sich auch auf europäischer Ebene mit dem Thema auseinandergesetzt. Bereits im Jahr 2015 unterzeichnete die „Parlamentarische Versammlung“ des Europarates eine Resolution zur Ratifizierung der Doppelresidenz als Standard (https://www.doppelresidenz.at/2015/10/03/europa-will-die-doppelresidenz/) . In dieser wird explizit darauf verwiesen, dass Eltern darüber aufzuklären sind, dass „die Doppelresidenz eine sinnvolle Option im besten Interesse des Kindes darstellt“. Alle Delegierten stimmten dafür (bei 2 Abwesenden). Keine Gegenstimme.
Ein Blick nach Europa zeigt, dass die überwiegende Mehrheit der Länder das Modell der Doppelresidenz bereits gesetzlich verankert hat. Die ehemaligen Ostblockstaaten, Skandinavien, die Benelux-Staaten, Frankreich und Spanien – überall gibt es das Modell bereits. Sogar die Schweiz hat die gesetzlichen Grundlagen dafür geschaffen und strebt nun eine verbindliche Form an, da sich Richter:innen in der Praxis noch öfter dagegen stellen. In den skandinavischen Ländern werden Kinder unter 10 Jahren zum überwiegenden Teil nach dem Doppelresidenzmodell betreut. Frankreich hat die Doppelresidenz seit 2001 unter sozialistischer Regierung eingeführt und das Modell gerade zu Beginn, wenn Eltern noch im Konflikt sind, zum Standard erhoben. Erst wenn das Gericht ein anderes Betreuungsverhältnis präferiert, kommt es zu einer Veränderung. Gegner:innen stoßen sich hierzulande daran, verteidigen aber mit gleicher Vehemenz, dass Väter im Streitfall erstmals auf 14-tägige Kontakte reduziert werden, auch wenn Kontinuität damit unterbrochen wird. Im Konflikt werden damit automatisch Väter unter Verdacht gestellt und Mütter implizit für sakrosankt erklärt (siehe oben).
Österreich und Deutschland sind im Zusammenhang mit der Doppelresidenz Europas Schlusslicht. In beiden Ländern gibt es einen ähnlichen (wie oben geschildert) dichotomischen Diskurs: hier die „Täter-Väter“, dort die „Opfer-Mütter“. Femizide und andere, aufs Schärfste zu verurteilende Gewaltdelikte gegenüber Müttern werden als Argument herangezogen. Selbstverständlich muss hier genau hingesehen und alle nur möglichen Schutzmaßnahmen getroffen werden. Alle Väter unter Generalverdacht zu stellen, schüttet jedoch das Kind mit dem Bade aus. Allein in Wien gibt es jährlich rund 10.000 Gefährdungsmeldungen. Im Großteil der Fälle sind Mütter als Gefährderinnen involviert, oder die Gefährdung geht überhaupt nur von ihnen aus (Verwahrlosung, psychische und physische Gewalt). Mütter deshalb pauschal zu verurteilen und jedenfalls von den Kindern zu trennen, wäre aber der völlig falsche Weg. Nahe liegt jedoch, dass das gegenwärtig vorherrschende Residenzmodell oder komplett abwesende Väter zu einer Überforderung der Mütter führt und dies zu diesen negativen Konsequenzen führt.
Eltern, Mütter wie Väter handeln ihren Kindern gegenüber aus Überforderung falsch. Ihre Intention ist es nicht, ihnen weh zu tun, egal auf welche Weise. In der Regel wollen sie das Beste für ihre Kinder, gehen aber den falschen Weg. Eben deshalb verbleiben die Kinder in den meisten Fällen bei den Müttern oder kommen nach einem Aufenthalt im Krisenzentrum wieder zu ihnen zurück. Die Mütter bzw. die Eltern werden in Folge dabei unterstützt, es in Zukunft besser zu machen. Eine insgesamt richtige Vorgehensweise.
Frauenschutzeinrichtungen hingegen fordern bei Vätern ungeachtet des Ausmaßes der Gewalt, dass sie sofort von den Kindern getrennt werden, ihnen das Sorgerecht entzogen gehört und sie erst nach einem Antigewalttraining wieder die Möglichkeit eröffnet werden soll, beides wiederzuerlangen.
In dieselbe Kerbe schlägt auch die Plattform fem.a. Medial omnipräsent werden immer wieder dieselben Botschaften verbreitet. Zuletzt dienten sie Moment.at als einschlägige Informationsquelle. Der Tenor: „Mütter sind Opfer und müssen geschützt werden.“ Stimmt. Aber eben nur zum Teil. Was völlig fehlt, ist eine Differenzierung. Ausgeblendet wird, wie sehr manche Mütter ihre Kinder in Trennungsprozessen instrumentalisieren, für sich vereinnahmen, Vätern mit dem Entzug derselben drohen und es auch umsetzen und Kindern damit psychisch Gewalt antun.
Redet man mit Müttern, aber auch Fachleuten unter vier Augen, werden diese Erfahrungen selbstverständlich bestätigt. Jede:r kennt dann plötzlich aus persönlicher Erfahrung oder aus dem unmittelbaren Verwandtenkreis Mütter, die nicht kindeswohl gerecht agieren, Väter ausgrenzen usw.
Bei derart agierenden Interessenvertretungen scheint man in einer anderen polarisierten Welt gelandet zu sein. Die Grundaussage: „Mütter brauchen kein Regulativ, sind sie geschützt, sind auch die Kinder geschützt.“ erfährt dort keine Relativierung. Mütter ganz ohne negativen Seiten.
Aber selbst aus feministischer Perspektive gibt es massive Einwände gegen diese einseitige Sichtweise. Mütter naturgegeben als den besseren Elternteil zu definieren, bestimmte Eigenschaften und Wesenszüge – Stichwort Mutterinstinkt – bei ihnen zu verankern, entspricht einfach nicht der Realität. Feministische Forscher:innen wie Badinter, Vinkens u.a.m. wehren sich dagegen vehement, widerlegen sie doch mit ihren Forschungen dieses Klischee und sehen gerade in diesen Wesenszuschreibungen eine große Gefahr für eine tatsächliche Gleichstellung der Geschlechter.
Kehren wir zurück zum lieben Geld. Frauen unterbrechen mit Geburt und Elternkarenz ihre berufliche Karriere und arbeiten danach in der Regel Teilzeit. Schaut man sich Umfragen an (https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/252657/geschlechter-un-gerechtigkeit-zur-vereinbarkeit-von-familie-und-beruf/#footnote-target-12) in denen der Frage nachgegangen wird, wie denn die Geschlechter zum Verhältnis vollzeitarbeitender Väter und teilzeitarbeitender Mütter stehen, dann wünschen sich zwar beide Geschlechter im Allgemeinen eine Annäherung in den Bereichen Familienarbeit und Erwerbstätigkeit. Aber nur ein kleiner Teil strebt eine Veränderung für sich selbst an. Der Großteil bevorzugt das bestehende Vollzeit/Teilzeit Modell. Eine Elternpaarbefragung des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung hat 2016 ergab, dass die gewünschte Erhöhung des Erwerbsumfangs von Müttern derzeit marginal ist. Und nur jede fünfte Frau wünscht sich, dass es eine Angleichung der Erwerbsarbeit in einem Korridor von 26 – 36 Stunden gibt (von den Männern wünscht es sich einer von vier).
Fassen wir zusammen:
Frauen sind nicht a priori die besseren Elternteile. Studien belegen eindeutig die Vorteile der Doppelresidenz. Sowohl Väter als auch Mütter wünschen sich zwar einen Ausgleich zwischen den Geschlechtern, was Erwerbstätigkeit und Familienzeit betrifft. Auf die eigene Person bezogen aber wollen sie allerdings keine Veränderung – Mütter wollen die Teilzeit-, Väter die Vollzeitarbeit beibehalten.
Was kann man darauf schließen? Die Gesellschaft befindet sich im Umbruch. Beide Geschlechter wünschen sich Veränderung und strecken ihre Fühler auf das jeweilige andere Terrain aus. Solange der zu beschreitende Weg unsicher ist, bleibt man jedoch lieber dort, wo man sich sicher fühlt und gesellschaftliche Akzeptanz genießt.
Die Scheidung/Trennung von Eltern wird damit zur Sollbruchstelle, an der gesellschaftliche Missverhältnisse sichtbar werden. Solange man sich aufeinander verlassen kann, wird die gegenseitige Abhängigkeit in den meisten Fällen akzeptiert. Väter sehen die gemeinsamen Kinder bei den Müttern in guten Händen. Mütter verlassen sich auf das Einkommen der Väter. Mit der Trennung werden die Defizite sichtbar. Väter haben das Kapital der finanziellen Ressourcen, vermissen aber die Beziehung zu ihren Kindern. Mütter haben das Kapital der Beziehung zu ihren Kindern, stoßen aber auf finanzielle Engpässe.
Gesellschaftliche Verwerfungen müssen nun auf privater Ebene gelöst werden. In der Regel einigen sich die Eltern auf eine gemeinsame Linie, sind aber nicht besonders glücklich damit. Beziehungsverlust hier, Doppelbelastung und finanzielle Unsicherheiten dort. Nachdem das Gesetz unklar bleibt und ein gesellschaftlicher Diskurs nur marginal stattfindet, werden die Kämpfe mehr. Und – die Familien werden mit dem Problem alleine gelassen.
Um aufeinander zugehen zu können, benötigen beide Geschlechter Sicherheiten. Frauenorganisationen aber wollen Vätern erst eine gemeinsame Obsorge zugestehen und die Doppelresidenz ermöglichen, wenn Frauen dieselben Gehälter haben und Männer genauso in Karenz gehen.
Wir haben gesehen, dass die Zahlen bei der Väterkarenz nicht allein deshalb stagnieren, weil Vätern nicht wollen. Beide Geschlechter stecken in Konventionen fest. Veränderungswille bei gleichzeitiger Verhaltenspersistenz gibt es bei beiden Geschlechtern gleichermaßen. Wir befinden uns in einer Übergangsphase, die es sowohl auf gesetzlicher, als auch auf der Bewusstseinsebene zu gestalten gilt. Und es stellt sich die Frage, was tun mit Vätern, die Sicherheit in der Beziehung zu ihren Kindern haben wollen, ohne in die Abhängigkeit vom Willen der Mutter zu geraten? Was tun mit Vätern, die bereits seit langer Zeit dem Anspruch nach halbe/halbe gerecht werden aber rechtlich benachteiligt werden? Verdienen sie keine Rechte und Sicherheiten nur weil sie noch in der Minderheit sind? Ist es legitim, Müttern ein absolutes Vetorecht einzuräumen, um eine Doppelresidenz zu verhindern, auch wenn sich Väter bereits bei aufrechter Beziehung hälftig beteiligt haben? Das nun aber ist der Status Quo.
Abgesehen davon sind die jetzigen Väter wichtige Rollenvorbilder für Burschen und Mädchen. Werden sich junge Väter aber jene zum Vorbild nehmen, die während aufrechter Beziehung auf Karriere verzichten und nach der Trennung wenig Einfluss darauf haben, wie viel Zeit sie mit ihren Kindern verbringen können?
Um einer Lösung näher zu kommen, müssen Gesetz und gesellschaftlich geprägte Verhaltensweisen vorerst getrennt betrachtet werden.
Die Einführung des Gleichstellungsgesetzes in den 70er Jahren hatte nicht die Voraussetzung, dass Frauen bereits zuvor überwiegend berufstätig sein mussten (Väter konnten ihnen die Berufstätigkeit bis dahin verbieten). Ebenso kann es nicht davon abhängen, dass Väter erst mehrheitlich in Karenz gehen und Familienarbeit gleichermaßen verrichten, bevor sie das Recht haben, nach einer Trennung die Doppelresidenz zu beantragen. Auch wenn noch wenige Väter in Karenz gehen, haben sie Anspruch auf gleiche Rechte und wollen nicht von der Willkür anderer abhängen. Oder anders betrachtet: Gleichstellung wird erst zu einer solchen, wenn es gleiche Rechte für alle gibt.
Das Antragsrecht auf Doppelresidenz verlangt aber schon allein der Umstand, dass Beziehungen und Bindungen nicht einfach auf ein Minimum reduziert werden dürfen. Beziehungskontinuität stellt für das Kind einen wichtigen Stabilitätsfaktor dar. Studien untermauern dies. Orientieren könnte sich das Gesetz bei der Umsetzung der Betreuungsverhältnisse an den vorgelebten Betreuungsanteilen. Ein Drittel der Betreuungszeit darf jedoch nicht unterschritten werden, weil erst damit sowohl Freizeit als auch Alltag mit dem Kind gelebt werden kann.
Versuchen wir, die Sache aus weiblicher Perspektive zu betrachten. Lange Karenzzeiten und Teilzeitarbeit mögen zwar auf der einen Seite durchaus auch den Wünschen vieler Mütter entsprechen (siehe Studie oben). Das Bedürfnis diese Situation im Wesentlichen beizubehalten, kann aber nicht getrennt von gesellschaftlichen Ansprüchen, mangelnden Kinderbetreuungsplätzen (vor allem in ländlichen Regionen), Problemen beim Wiedereinstieg bzw. der Aufstockung von Teilzeit auf Vollzeit gesehen werden. Eine schlechtere finanzielle Ausgangslage für Mütter ist dementsprechend in vielen Fällen nicht vermeidbar. Bis sich diesbezüglich was ändert, wird es noch lange dauern. Lösungen für eine Übergangsfrist sind nötig.
Es geht also nicht um ein entweder – oder, sondern um ein sowohl als auch.
Eine Denkvariante könnte sein, dass Mütter, die vor der Trennung Teilzeit gearbeitet haben, beim Modell der paritätischen Doppelresidenz, während einer Übergangsphase einen Ausgleichsanspruch von (in der Regel) besser verdienenden Vätern geltend machen könnten. Je länger die Teilzeitarbeit vor der Trennung, umso länger der finanzielle Ausgleich. Nachdem Mütter (in der Regel) durch die Doppelresidenz auch die entsprechenden zeitlichen Ressourcen hätten einen Ganztagsjob annehmen zu können, könnte eine Übergangsfrist von einem halben bis maximal zwei, drei Jahren eine Denkvariante darstellen.
Damit gäbe es eine finanzielle Absicherung für Mütter, eine rechtliche Absicherung für Väter und für die Kinder die Sicherheit nicht die Beziehung zu einem Elternteil zu verlieren. Der Doppelbelastung der Mütter würde entgegengewirkt werden. Ebenso der Angst von Vätern, nach der Trennung Elternteil zweiter Klasse zu werden.
Aufbauend auf dieser Rechtsgrundlage könnten weitere Schritte gesetzt werden, um gesellschaftliche Veränderungen voranzutreiben. Vorstellbar wären:
- Ein Rechtsanspruch auf Kinderbetreuungsplätze ab dem zweiten Lebensjahr
- Ein Rückkehrrecht von Teilzeit auf Vollzeit
- Ev. ein “Kinderbetreuungsgeld Plus” nach deutschem Vorbild (wenn beide Elternteile ab dem 14. Lebensmonat des Kindes Teilzeit arbeiten, bekommen sie eine Förderung bis zum 32. Lebensmonat des Kindes)
- Wichtig wäre es darüber hinaus, Bewusstseinsbildung in den Betrieben zu machen, um Karenzurlaub auch Vätern besser zugänglich zu machen
- Leitungsfunktionen trotz Teilzeit sollten gefördert werden (in Skandinavien Gang und Gäbe, ja sogar ein Vorteil)
Für den Verein WIR VÄTER
Anton Pototschnig
Dipl. Sozialarbeiter und Obmann