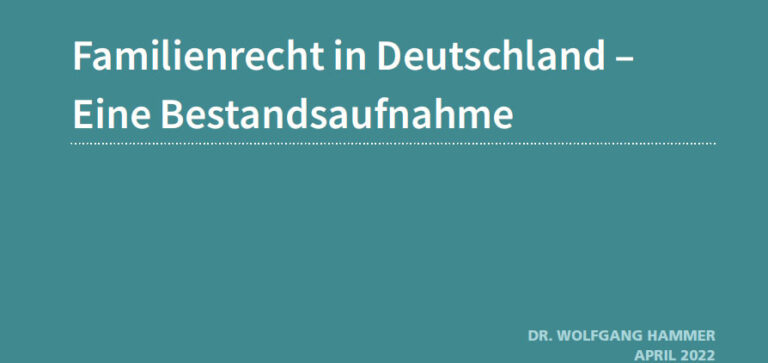Kampf ums Kind – Arithmetisch gerecht, oder Salomonisch?
 In der jüngsten Ausgabe der Wiener Zeitung wurde eine wichtige Debatte über das Kindschaftsrecht gestartet. Anton Potoschnig, wir-vaeter.at und Doppelresidenz.at Obmann, betrachtet in seinem Beitrag „Wenn Mütter Ihre Macht mißbrauchen“, die Lage getrennter bzw. geschiedener Männer und ihre Chancen auf Kontakt zu ihren Kindern, wenn dieser ihnen verweigert wird. Andrea Czak, Obfrau von FEMA, meinte in Ihrem Beitrag „War es das, was Salomon wollte?“, dass nüchterne Mathematik das falsche Mittel sei, wenn es um das Kinderwohl gehe.
In der jüngsten Ausgabe der Wiener Zeitung wurde eine wichtige Debatte über das Kindschaftsrecht gestartet. Anton Potoschnig, wir-vaeter.at und Doppelresidenz.at Obmann, betrachtet in seinem Beitrag „Wenn Mütter Ihre Macht mißbrauchen“, die Lage getrennter bzw. geschiedener Männer und ihre Chancen auf Kontakt zu ihren Kindern, wenn dieser ihnen verweigert wird. Andrea Czak, Obfrau von FEMA, meinte in Ihrem Beitrag „War es das, was Salomon wollte?“, dass nüchterne Mathematik das falsche Mittel sei, wenn es um das Kinderwohl gehe.
Lesen Sie nachfolgend beide Beiträge im Volltext und auch die zusätzliche Online-Replik von Anton Pototschnig auf den Beitrag von Andrea Czak.
Print-Beitrag von Anton Potoschnig (eine ausführlichere, ungekürzte Online-Version ist auf der Webseite der Wiener Zeitung abrufbar, Download als PDF):
Wenn Mütter ihre Macht missbrauchen
Wird Vätern bei Trennung oder Scheidung der Kontakt zum Kind verweigert, sind sie so gut wie chancenlos.
Von Anton Pototschnig
Bald ist Vatertag. Ein guter Zeitpunkt, um darauf aufmerksam zu machen, dass Väter im Zuge von Trennungen und Scheidungen systematisch Benachteiligung und Ausgrenzung erfahren, der weder Politik noch Medien entgegenwirken. Rund 13.500 Ehen werden pro Jahr geschieden, mit mehr als 17.000 betroffenen Kindern, Lebensgemeinschaften nicht mitgerechnet.
Es kommt zu einer völligen Schieflage im Verhältnis zum Kind. Mütter missbrauchen ihre Vormachtstellung und verweigern Vätern in vielen Fällen trotz Gerichtsbeschluss den Kontakt zu den Kindern, geben sie beim Besuchskontakt einfach nicht heraus oder melden sie „krank“. Wollen Väter den vereinbarten Urlaub mit den Kindern antreten, sind plötzlich die Mütter mit diesen verreist. Konsequenzen hat das für die Mütter so gut wie nie. Betroffene Väter gibt es tausende, die sich in Vereinen organisieren, aber keinerlei Unterstützung erfahren. Im Gegenteil.
Das Justizministerium weiß Bescheid, tut aber nichts
Gerichte schauen oft jahrelang weg, sind befangen und parteiisch und ignorieren konsequent Gutachten, die sich für mehr Betreuungszeit von Vätern aussprechen. Das Justizministerium weiß Bescheid, tut aber nichts. Anwälte wenden sich an die Ombudsstelle der Justiz, bringen Dringlichkeitsanträge, Dienstaufsichtsbeschwerden, Ablehnungsanträge, bis hin zu Anzeigen wegen Amtsmissbrauch ein. Ohne Resultat.
Verweigert die Mutter dem Vater den Kontakt zum Kind – auch wenn gegen ihn offensichtlich nichts vorliegt – wird sie in Beratung geschickt. Das Justizministerium lehnt Sanktionen entschieden ab, womit in der Praxis der Entfremdung der Kinder von ihren Vätern und dem Machtmissbrauch durch die Mütter Tür und Tor geöffnet wird. Nimmt die Mutter die Beratung nicht an, wird ein Gutachten erstellt. Wird darin festgestellt, dass der Vater ein „Guter“ ist und die Kinder entsprechend Kontakt haben sollen, aber die Mutter hält sich nicht daran, wird ein weiteres Gutachten bestellt. Jedes dieser Gutachten dauert im günstigsten Fall sechs Monate. Während dieser Zeit gibt es keinen Kontakt zwischen Vater und Kind. Bis alles durch ist, hat es den Vater oft über Jahre nicht mehr gesehen und ist so manipuliert, dass ein Kontakt allein deshalb nicht mehr möglich ist.
Eine Beschleunigung der Verfahren – das beste Mittel gegen mütterlichen Machtmissbrauch – mit schneller Abklärung einer möglichen Gefährdung und Feststellung, ob es sich um einen symmetrischen oder einen asymmetrischen Konflikt handelt, ist nicht vorgesehen. Dabei ist es überall dort Standard, wo man das Thema ernst nimmt.
Fordern Väter Sanktionen, so heißt es: „Druck auf die Mutter landet letztlich immer auf dem Rücken des Kindes.“ Traumatisch scheint einzig die Trennung von der Mutter, nie die vom Vater. Da kann die Bindung zwischen Vater und Kind noch so fest sein. Schließen sich Väter zusammen, um auf dieses Ungleichgewicht aufmerksam zu machen, werden sie als „Väterrechtler“ punziert, mit Betonung auf „rechts“. Und in dieser Schublade muss man sie nicht mehr ernst nehmen. Fordern Vätervereine die gleichen Rechte, heißt es: „Denen geht es immer nur ums Recht, nicht ums Kind.“
Zweierlei Maß bei der Bewertung der Bindung
Wollen Väter nach der Trennung die Doppelresidenz, heißt es: „Nicht auf die Quantität, auf die Qualität der miteinander verbrachten Zeit kommt es an.“ Geben sie nicht klein bei, hören sie Moralinsaures wie: „Um Kinder kämpft man nicht.“ Dass Mütter nicht kämpfen müssen, weil sie die Kinder haben, interessiert nicht. Sind die Kinder unter drei Jahren, heißt es: „Eine zu lange Unterbrechung der Kontakte beeinträchtigt das Kind in seiner Bindung zur primären Bezugsperson“ und Väter müssen sich mit zwei bis drei Stunden pro Woche zufriedengeben. Dass Mütter ihre Kinder ab dem ersten Lebensjahr in Krippen oder zu Tagesmüttern bringen, wo sie von ihnen völlig fremden Personen betreut werden, scheint das Bindungsgeschehen nicht zu beeinträchtigen. Leben Väter die Doppelresidenz und geben dabei die Kinder für einige Stunden der Oma, wird ihnen vorgeworfen, an ihren Kindern gar nicht interessiert zu sein, sondern nur Unterhalt sparen zu wollen. Überlassen berufstätige Mütter ihre Kinder den Großeltern, obwohl der Vater die Kinder im selben Zeitraum betreuen möchte, heißt es: „Eine Mutter hat das Recht, die Betreuung ihrer Kinder selbst zu organisieren.“
Warum dürfen Missstände nicht auf beiden Seiten benannt werden? Weil Mütter in ihrer Bedeutung dem Kind gegenüber mystifiziert werden. Weil Frauen, so scheint es, nur Opfer sind und ein differenzierter Blick fehlt. Weil ein entsprechender Diskurs streng entlang der Linie „da Täter- Väter, dort Opfer-Mütter“ verläuft. Weil Frauenschutzeinrichtungen dieses Schwarz/Weiß-Bild bei jeder Gelegenheit befördern. Weil die Politik das Thema ignoriert und Medien – besonders jene, die investigative Aufgaben haben – das Thema nicht anrühren.
Ich bin ein Väterrechtler. Ich bin stolz darauf. Ich klage an.
Print-Beitrag von Andrea Czak im Volltext:
War es das, was Salomon wollte?
Wenn es ums Kindeswohl geht, ist nüchterne Mathematik das falsche Mittel
Von Andrea Czak
In vielen Staaten Europas und den USA gibt es seit einigen Jahren einen besonderen Trend im Familienrecht: Kinder sollen nach der Trennung der Eltern „gerecht aufgeteilt“ werden. „Gerecht“ bedeutet zumeist: „arithmetisch gerecht“ – sie sollen also zu gleichen Teilen (50:50) bei beiden Elternteilen leben. Trennungskinder haben dann statt eines Zuhauses zwei. Die Doppelresidenz, die vorsieht, dass Kinder eine Woche bei Papa und eine bei Mama sind, ist in diesem Zusammenhang fast zum Kampfbegriff geworden.
Schwierig wird es, wenn dieses arithmetische Modell nicht einvernehmlich festgelegt werden kann, weil eine Seite – in vielen Fällen die Mutter – auf der Bremse steht. Im gängigen Familienrecht wird dann häufig Druck aufgebaut, sich diesem dennoch anzunähern. Gutachten und Berichte werden erstellt, nicht selten wird in Gesprächen Khalil Gibran zitiert: „Eure Kinder sind nicht eure Kinder. Sie sind die Söhne und die Töchter der Sehnsucht des Lebens nach sich selber.“
Arithmetisch sauber
Als Bild wird Müttern und Vätern das Urteil König Salomons vor Augen geführt: „Wollt ihr euer Kind in der Mitte zerteilen?“ Diese Frage, direkt ausgesprochen oder nicht, schwingt hier mit. Wollt ihr das nicht, so lasst los! Das Loslassen versteht sich hauptsächlich als Appell an die Mutter: Sie soll loslassen, um das Kind „gerecht“ auf zwei Wohnsitze aufteilen zu können. War es das, was Salomon wollte?
Mathematik und ein Schuss Esoterik sind es also, die zu einer guten Lösung in Kontaktrechtsverfahren führen sollen. Dies entspricht unserem Zeitgeist. „Unser Leben ist darauf gegründet, möglichst alles auszurechnen“, sagt die Wiener Konfliktforscherin und Psychoanalytikerin Susanne Jalka und fügt hinzu: „Es ist unglaublich, wie sehr wir uns in allen Bereichen unseres Lebens auf Zahlen stützen. Dabei merken wir gar nicht, dass wir keine Rechenmaschinen sind, sondern lebendige Menschen mit Stärken und Schwächen und allem, was dazu gehört.“ Passend zum ökonomisch ausgerichteten Denken favorisieren die meisten der für die Familiengerichte tätigen Stellen systemische und (verhaltens)pädagogische Ansätze. Diese lassen leider allzu oft den Blick auf den Längsschnitt vermissen.
Eine der wichtigsten Begutachtungsinstitutionen, die Gerichten im Rahmen der jüngsten Gesetzesänderung im Jahr 2013 als Hilfestellung zugeschaltet wurde, die sogenannte Familiengerichtshilfe, wird seit ihrer Gründung von einer Systemischen Therapeutin geleitet. Die dort tätigen Berufsgruppen – Bildungswissenschafterinnen, Sozialarbeiterinnen und nur zu einem Teil Psychologinnen – beziehen sich in ihren Berichten allesamt auf pädagogische Literatur, die wiederum zu 100 Prozent dem Diktum der Umsetzung eines „modernen Familienrechts“ folgt – und modern ist die Doppelresidenz.
Kinder als Pendler
Es ist dieses Modell, das letztlich am besten in unsere flexible, neoliberale Gesellschaft passt. „Kinder, die so aufwachsen, lernen früh mobil zu sein“, sagt etwa der Universitätspsychologe Harald Werneck, der sich die Erforschung der Doppelresidenz auf die Fahnen geheftet hat. Wer heute noch den Begriff „Heim erster Ordnung“ verwendet, gilt rasch als altmodisch oder wird verunglimpft, die Bedeutung der Väter nicht zu sehen. „Kinder brauchen einen Ort, an dem sich um alles gekümmert wird“, sagt aber die langjährige Rechtspsychologin Rotraut Erhard und fügt hinzu: „Ja, Kinder brauchen auch Kontakt zu beiden Eltern. Aber nicht unbedingt gleich viel.“ Sie ist nur eine von vielen – zugegebenermaßen leise gewordenen – Stimmen, die an die Wichtigkeit von Verwurzelung erinnern.
Waren bis in die 2000er Jahren Männer tatsächlich benachteiligt durch ein einseitiges Familienrecht, das ihnen nicht gestattete, die gemeinsame Obsorge gegen den Willen der Kindesmutter zu beantragen, scheint das Pendel nun in die andere Richtung auszuschlagen. Männer sollen, ja müssen häufig genau die Hälfte der Zeit bekommen. Das Diktum „Kinder brauchen beide Eltern“ verschluckt jegliche Form von kritischer Reflexion, was das im Alltag konkret bedeutet. So werden schon sehr junge Kinder zu Pendlern – ungeachtet, ob dies ihrem Naturell entspricht oder nicht.
Kein Mensch wird sich gegen ein Doppelresidenzmodell aussprechen, wenn es im Einvernehmen gelebt wird und – das ist der zentrale Punkt – dem Kind guttut. Die Doppelresidenz kann nicht funktionieren, wenn Kinder offensichtlich damit überfordert sind, wenn Gewalt im Spiel ist oder es nicht den Funken einer Gesprächsbasis zwischen den Eltern gibt. Wird die Doppelresidenz von einer Person einseitig vor Gericht durchgeboxt, so ist dies regelrecht paradox. Wie kann man zwangsweise ein Modell etablieren, das die höchste Kooperationsbereitschaft überhaupt erfordert? Dazu die Psychologin und gerichtlich beeidete Sachverständige Sandra Szynkariuk-Stöckl: „Man müsste eigentlich schon das hinterfragen: dass sich hier eine Person mit solcher Wucht über die Meinung eines anderen hinwegsetzen will.“
Das Ziel einer ehrlichen Auseinandersetzung von Müttern und Väter – und allen rund ums Familienrecht tätigen Personen – sollte sein, den scheinbaren „Modernisierungsschub“ kritisch zu hinterfragen. Es geht um Mut zur Differenzierung und ein Anerkennen von Komplexität. Dafür braucht es die Rückbesinnung auf Ansätze, die im Familienrecht verloren zu gehen drohen: tiefenpsychologische und humanistische Betrachtungen zu dem, was Kindeswohl auch sein könnte und das Abrücken von schädlichen und vereinfachenden Narrativen.
Replik von Anton Pototschnig auf den Beitrag von Andrea Czak:
Arithmetisch gerecht, oder Salomonisch?
Andrea Czak fordert in Hinblick auf das Kindschaftsrecht eine differenzierte Sichtweise und die Anerkennung von Komplexität, will unterm Strich aber nichts anderes, als in Entscheidungsfragen rund ums Kind „das letzte Wort der Mutter“, zu zementieren.
Um diese Absicht zu verklären, tischt sie uns „kühle Arithmetik“ auf, wo Menschlichkeit gefragt wäre und beruft sich auf Salomon, der es wohl besser wüsste. Schauen wir genauer hin:
Andrea Czak meint richtig: Sind Kinder überfordert mit dem Modell der Doppelresidenz, kann es nicht funktionieren. Hier stimme ich ihr zu. Die Frage allerdings ist, wer beurteilt das? Nicht selten, wird dieser Umstand einfach behauptet oder schlicht als theoretische Konstante in die Diskussion geworfen. Tatsächlich gibt es nur extrem selten den Fall, wo Kinder damit überfordert sind, viel öfter aber wird es von Müttern einfach behauptet, weil es ihren Vorstellungen nicht entspricht.
Andrea Czak wirft weiters ein, dass die Doppelresidenz bei Gewalt nicht in Frage kommt. Auch da eine bedingte Zustimmung. Das von ihr eingeforderte Moment der Differenzierung sollte aber spätestens hier zum Greifen kommen. Ich arbeite seit 32 Jahren im Bereich der Jugendwohlfahrt. Viele Kinder werden bei Müttern belassen oder nach kurzer Zeit wieder aus dem Krisenzentrum rückgeführt, wurden sie auch vorher von Müttern geschlagen oder psychisch gequält. Ich finde zu Recht. Warum aber sollte Gewalt – ungeachtet des Ausmaßes und der Zielrichtung – ausnahmslos ein Hinderungsgrund bei Vätern sein? Selbstverständlich muss ausgeschlossen werden, dass es zu keiner Wiederholung kommt und selbstverständlich kommt es aufs Ausmaß an. Selbstverständlich darf es durch den Kontakt zu keiner Retraumatisierung kommen. Nicht anders als bei Müttern, die ihre Kinder mit Gürteln, Kochlöffeln oder Schuhen blutig schlagen und trotzdem wieder in die Erziehungsverantwortung kommen. Es gilt zu differenzieren, genau hinzuschauen und zu schützen. Ist der Schutz des Kindes nicht gegeben, muss es beim Kontakt Einschränkungen geben – nicht nur bei der Doppelresidenz, nicht nur bei Vätern.
Andrea Czak fordert aber auch, dass die Doppelresidenz nicht umgesetzt werden darf, wenn es zwischen den Eltern keine Gesprächsbasis gibt oder sie gegen den Willen eines Elternteiles durchgesetzt werden soll. Sprechen wir Klartext, gemeint ist: Nicht gegen den Willen der Mutter. Leider passiert in vielen Fällen genau das (siehe Beispiele in meinem Kommentar). Ungeachtet dessen, wie das Engagement der Väter bei aufrechter Beziehung war und wie intensiv die Bindung zwischen Vater und Kind ist.
Nicht gegen den Willen der Mutter eine Doppelresidenz anzuordnen bedeutet, Müttern das uneingeschränkte Bestimmungsrecht zu geben. Ungeachtet dessen, ob eine Mutter dem Modell nur entgegensteht, weil sie gekränkt ist, weil sie rachsüchtig ist, weil sie Angst hat das Kind ganz zu verlieren, weil sie die neue Lebensgefährtin des Vaters nicht erträgt, weil sie eine Persönlichkeitsstörung hat oder sie einfach mehr Alimente haben will.
Mit dieser Forderung – nicht gegen den Willen einer Mutter – stellt man diese über das Gesetz, erklärt sie für sakrosankt und spricht ihnen „das Böse“ ab. Mit dieser Forderung werden Mütter mystifiziert und ihnen Kindern auf Gedeih und Verderb ausgeliefert, ungeachtet möglicher obiger Eigenschaften.
Keine Gesprächsbasis zu haben ist definitiv kein Ausschließungsgrund. Es genügt via sms, WhatsApp, oder per Mail zu kommunizieren. Erfahrungen und Wissenschaft beweisen es. Liebe Frau Czak. Bitte nehmen sie ihre eigenen Maxime ernst und beginnen sie zu differenzieren.Ah ja und Salomon. Ich kenne unzählige Väter, die beim Gezerre ums Kind loslassen, weil sie ihm nicht schaden wollen und lieber auf Zeit verzichten als den Kampf fortzusetzen. Wir wissen für wen sich Salomon entschieden hat.
Anton Pototschnig
Wie ist Ihre Meinung zum Thema? Diskutieren Sie mit auf Social Media (Hashtag #IchbinVäterrechtler) oder senden Sie ihren Leserbrief an leser@wienerzeitung.at und in Kopie an leserbriefe@wir-vaeter.at (Details zur Veröffentlichung auf wir-vaeter.at)